
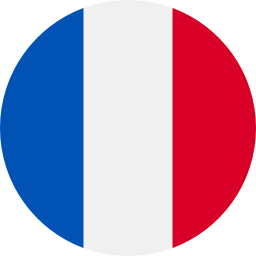 27. Juli 2012 • Opinion •
27. Juli 2012 • Opinion •
Frankreich und Deutschland bilden mit rd. 50% des BIP der Eurozone ihren Grundpfeiler. Wird einer dieser Pfeiler fragil, ist das gesamte Gebäude bedroht. Selbst wenn Deutschland seinen Teil der Verantwortung an den derzeitigen Rettungsaktionen der Eurozone tragen kann, wäre es damit überfordert, die finanziellen Probleme Europas alleine zu schultern. Es braucht einen Partner, der solide ist. Dieser ist es jedoch nicht.
Die Staatsausgaben in Frankreich sind die höchsten weltweit. Sie belaufen sich auf 56% des BIP und sind damit 10,5 Prozentpunkte höher als in Deutschland. Je mehr der Staat ausgibt, desto höher werden die Unternehmer besteuert. Deren Steuer- und Sozialabgaben liegen um rd. 150 Mrd. € höher als bei ihren deutschen Konkurrenten, d.h um 7 Prozentpunkte des BIP höher als in Deutschland in 2009. Die Folgen sind ein kräftiger Rückgang der Unternehmensgewinne, die seit 2000 um rd. 25% gesunken sind. Der Verlust an Wettbewerbsfähigkeit führt zu einer Belastung des französischen Außenhandels, die seit 1998 das Wirtschaftswachstum jährlich um 20% dämpft. Das gebremste Wirtschaftswachstum hat wiederum einen Anstieg der Arbeitslosigkeit zur Folge. Aus diesem Grund war die Arbeitslosigkeit in Frankreich in den letzten 10 Jahren vor Ausbruch der Finanzkrise durchschnittlich 40 % höher als in Industrieländern und ist derzeit um 70% höher als in Deutschland. Der Beschäftigungsrückgang seinerseits führt zu sinkenden Steuereinnahmen und zu steigenden Sozialausgaben und damit wieder zu höheren Steuern. Frankreich ist seit Jahren in diesem Teufelskreislauf gefangen.
Das Institut Thomas More, ein französisch-belgischer think tank, hat kürzlich in einer Studie den öffentlichen Dienst Frankreichs mit dem in Deutschland verglichen. Dabei wurden 100 Mrd €, d.h. rd. 5 Prozentpunkte des BIP, als potenzielle Ersparnis in der öffentlichen Verwaltung identifiziert, allein durch Abbau von Ineffizienzen und Produktivitätssteigerung, ohne Eingriffe in die Leistungen des großzügigen französischen Sozialsystems vorzunehmen. Die französischen Industrie, die die unzureichende Effizienz des öffentlichen Dienst durch höhere Abgaben zu schultern hat, leidet folglich an einer verminderten Wettbewerbsfähigkeit. Unter der Voraussetzung einer gleichen Lohn- und Gehaltssumme würden die Arbeitskosten in Frankreich um 20% sinken.
Die französische Öffentlichkeit weigert sich allerdings, dies zur Kenntnis zu nehmen und daraus die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Das im April der EU vorgelegte Stabilisierungsprogramm sieht eine Anhebung der Steuern und Abgaben um 3,3 Prozentpunkte des BIP zwischen 2010 und 2016 bei einer Rücknahme der Ausgaben des öffentlichen Sektors um 1,6 Prozentpunkte des BIP vor. Seitdem haben in Frankreich Wahlen stattgefunden. Der Rechnungshof hat soeben einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf ab 2013 von 1,6 Punkten des BIP, besonders zur Erfüllung der eingegangenen Wahlversprechen festgestellt. Würde man, wie vorgeschlagen, die Hälfte davon durch höhere Steuern finanzieren, würde dies den Anstieg der Steuer- und bgabenquote beschleunigen und damit den Abstand zu Deutschland, der 2010 bereits 6,2% des BIP betrug, noch weiter anschwellen lassen.
Die Perspektive einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der französischen Industrie durch Steuererleichterungen besteht daher nicht. Die Verschlechterung scheint sich vielmehr fortzusetzen. Das Wirtschaftswachstum in Frankreich wird damit weder durch den Außenhandel, noch durch die Inlandsnachfrage, deren Kaufkraft ohnehin durch den Steuerauftrieb gedämpft wird, noch durch eine keynesianische Wirtschaftspolitik angekurbelt werden können. Im besten Fall kommt es zu einem trägen Wachstum, das um so mehr die Erfüllung der auf europäischer Ebene eingegangenen Verpflichtungen erschwert und damit letztlich zu einem Risiko für den Euro und für Europa wird : Als Dominostein kann Frankreich das ganze System erschüttern.
Zwischen 1945 und 2000 wurde der Franc jedes Jahrzehnt durchschnittlich um ein Drittel gegenüber der D-Mark abgewertet zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit, die durch inflationäre Exzesse bei den Staatsausgeben erodierte. Während des gesamten Prozesses der europäischen Integration haben wir uns eingeredet, wir könnten uns in Richtung des deutschen Systems entwickeln in der Erkenntnis, daß eine Währungsunion bei strukturellen Divergenzen der Wirtschaftsmodelle beider Pfeiler nicht überleben kann. Dies war der Geist des Vertrages von Maastricht. Tatsächlich haben wir jedoch die gleiche Politik verfolgt, allerdings mit anderen Mitteln. Einerseits haben die « Währungsschlange » der 70er Jahre sowie später der Euro uns die Inflationierung als wirtschaftspolitisches Instrument aus der Hand genommen, dafür haben sie es uns aber ermöglicht, uns zu günstigen Konditionen fortlaufend zu verschulden.
Deutschland will heute die Schwächen des alten Systems durch einen neuen Vertrag
überwinden und hat damit recht. Allerdings kann man sich nicht mehr mit einem juristischen oder buchhalterischen Ansatz zufrieden geben. Die besten Bestimmungen der Welt können den fehlenden Willen der Vertragsparteien nicht ersetzen. Dieser ist auf unserer Seite immer noch nicht vorhanden: Zwei Traditionen, zwei geschichtliche Erfahrungen, zwei Kulturen, die sich gegenüber stehen. Wenn wir uns nicht ändern, ist das System nicht überlebensfähig.
Wenn Frankreich sich dagegen seinen Partnern annähert, indem es seine Wirtschaft durch eine erhebliche Ausgabensenkung reformiert, würde es sich auf einen stärkeren Wachstumspfad begeben, würden die notwendige europäische Integration und die Pläne zur Eurorettung glaubwürdiger und das Vertrauen der Finanzmärkte gestärkt. Damit würde letztlich ein positiver Kreislauf in Gang gesetzt.
Des Weiteren würde auch die französische Verhandlungsposition, besonders zur Ausweitung der Kompetenzen der Europäischen Zentralbank zur Wachstumsförderung gestärkt, um der EU geldpolitisch Luft zu verschaffen. Wenn wir einen großen Schritt zur Konvergenz unserer Wirtschaft mit dem deutschen Modell unternähmen, wäre Deutschland eher bereit, seine Verhandlungsposition zu flexibilisieren. Der Schlüssel für die Zukunft Europas liegt zweifellos im französischen Lager, entweder aufgrund eigener Initiative oder auf Druck seiner Gläubiger oder seiner Partner.

